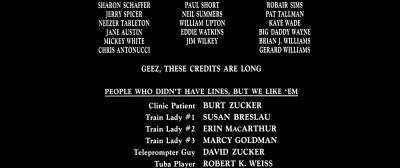Heute gibt es nahezu keine Konzerte mehr, auf denen Leinwände nicht als audiovisuelle Vermittlerinnen dienen. Das Publikum ist dabei ein wichtiger Akteur, dessen individuelle Konzerterfahrung durch die Bildschirme beeinflusst wird.
Seit 1927, als The Jazz Singer die US-amerikanischen Leinwände eroberte und in den Folgejahren der Tonfilm weltweit in den Kinos Anklang fand, gilt die Musik als nahezu unentbehrliches Element für den Film. Musik und Kino bilden so gesehen eine Einheit, die auch in entgegengesetzter Beziehung stattfindet. So sind spätestens seit den 1990er Jahren überdimensional große LED-Bildschirme und Leinwände auf musikalischen Großveranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Allein schon aus praktischen Gründen leisten die elektronischen Installationen dem Publikum gute Dienste, denn sie bilden die Künstler:innen auf der Bühne in überlebensgroßer Form ab, was allen vor der Bühne Versammelten – unabhängig von ihrer Position - eine gleichermaßen gute Sicht bietet. Sowohl zur Musik als auch zum Film gehört das Publikum. Musik wird gemacht, um gehört zu werden, genau wie Filme gemacht werden, um gesehen zu werden. Dabei beeinflusst das gemeinsame Schauen eines Filmes und das gemeinsame Zuhören die individuelle Seh- und Hörerfahrung. Im Grunde existiert auf Konzerten eine Beziehung zwischen drei Akteur:innen: Den Künstler:innen, dem Publikum und der Leinwand. Die Leinwand ist zwischen Künstler:innen und Publikum geschaltet und fungiert als eine Art Vermittlerin. Sowohl auf Konzerten als auch im Kinosaal. Eine interessante Frage ist, wie sich das Publikum zum Bildschirm verhält. Vor allem, wenn die Leinwand nicht nur die Rolle der Vermittlerin einnimmt, sondern auch die eines Spiegels.
Hockenheim Ring, 21.07.2023.
Letzten Sommer war ich auf einem Open-Air Konzert von Bruce Springsteen mit mehr als 80.000 Zuschauer:innen. Unsere Plätze waren nicht mal schlecht – wir standen im zweiten Abschnitt vor der Bühne – und trotzdem waren wir auf die überdimensional großen Bildschirme angewiesen, um Mimik und Gestik des Künstlers und seiner Band erkennen zu können. Nur mit Mühe schaffte man es, einen Blick über die Köpfe der Masse hinweg auf den Künstler zu erhaschen. Parallel zum Geschehen auf der Bühne wurde dem Publikum eine digitale Version des Konzertes dargeboten – und das gleich auf drei Bildschirmen, die drei verschiedene Kameraperspektiven zeigten. Ein Live-Film, parallel zu der `realen´ Performance auf der Bühne, hinter dem ein Konzept, eine Regie und ein Kamerateam steckte. Verschiedene Instanzen, die entscheiden, welche Ausschnitte das Publikum zu einer bestimmten Zeit auf den Monitoren zu sehen bekommt. Ich merkte, wie es für mich fast natürlicher erschien, den Blick auf die Bildschirme zu richten als auf die Bühne. Es schien dort einfach mehr zu passieren. Schaute ich auf die Bühne, hatte ich fast schon das Gefühl, etwas Wichtiges zu verpassen. Auf den Bildschirmen bekam man gleich eine durchkomponierte Montage zu sehen: Springsteen in einer Halbnahen – Schnitt – Springsteen in einer Großaufnahme – Schnitt – Springsteen und seine Band in einer Totalen. Es war einfacher – der Blick des Publikums wurde durch die Kamerafahrten automatisch gelenkt. Trotzdem ließ ich hin und wieder meinen Blick über die Menge schweifen, nahm das Publikum wahr, nahm die Atmosphäre wahr, die durch die Anwesenheit dieser Tausenden von Menschen geschaffen wurde. Dem Rest des Publikums schien es ähnlich zu gehen wie mir: Ihre Blicke richteten sich größtenteils auf die Leinwände. Manche von ihnen hielten ihre Smartphones über ihre Köpfe, filmten die Bühne und die Bildschirme. Unfreiwillig blickte ich durch etliche, kleine Bildschirme in meinem Blickfeld. Obwohl ich vor Ort – auf einem Live-Konzert war – sah ich das Konzert größtenteils durch Bildschirme.
Dann passierte etwas, das ich nicht hatte kommen sehen. Plötzlich blickte ich mir auf einem der Monitore selbst ins Gesicht. Denn was hin und wieder geschah – die Kameras filmten ins Publikum und übertrugen ihr Bild auf die Leinwände – passierte auch jetzt. Das Publikum wurde in diesen Momenten selbst Teil des Filmes, der sich auf den Leinwänden hinter der Bühne abspielte. Es manifestierte sich selbst auf der Leinwand. Auf diese Weise wurde die Leinwand zum Bindeglied zwischen Künstler und Publikum und schaffte einen Raum der Begegnung. Das auf der Leinwand versammelte Publikum konnte man als nichts anderes als eine Gemeinschaft wahrnehmen, war es doch zumeist schwierig, eine bestimmte Person aus der Masse auf dem Bildschirm erkennen zu können. Eine Nahbarkeit zwischen Künstler und Publikum wurde auf der Leinwand geschaffen: Dort wo eben noch Springsteen performte, erschien nun eine Masse an Zuschauenden. Diese Interaktivität – Teil des Filmes zu sein – konnte nur durch den Bildschirm möglich gemacht werden. In dem Moment, indem ich mich selbst auf der Leinwand spiegelte, wurde ich Teil der Performance, die über 80.000 Menschen sahen.
Mainz, Wohnzimmer, 22.06.2024.
Erst vor einigen Tagen schaute ich in meinem Wohnzimmer auf ARTE einen Live-Stream des The National-Auftrittes auf dem Southside-Festival. Diese Situation bot eine weitere Perspektive des Zusammenspiels zwischen Publikum, Bildschirm und Künstler:innen. Ich (Publikum), in meinem Wohnzimmer, verfolgte über meinen Fernseher (Bildschirm) die Performance der Band (Künster:innen) auf der Bühne. Je nachdem welcher Kameraausschnitt übertragen wurde, sah ich die Band sowohl auf der Bühne performen, als auch auf den Leinwänden (Bildschirm), die an der Bühne angebracht waren. Auch Aufnahmen des Publikums wurden übertragen. Ich war dabei in einer ungewöhnlichen Lage: Ich war eine virtuelle Zuschauerin, die irgendwie am Geschehen, das zur gleichen Zeit an einem anderen Ort stattfand, teilnahm. Ich nahm das Publikum wahr, welches wiederum nicht ahnen konnte, dass ich in diesem Moment als virtuelle Zuschauerin existierte. Der Bildschirm bei mir im Wohnzimmer schuf diesmal eine unüberbrückbare Distanz im Vergleich zur Nahbarkeit, die ich empfand, als ich auf dem Bruce Springsteen-Konzert auf dem Bildschirm erschien. Als Zuschauerin zu Hause auf dem Sofa nahm ich wahr, wie isoliert ich von diesem Konzert war: Ich saß alleine in meinem Wohnzimmer, es war still, bis auf den Ton des Fernsehers, den ich jederzeit hätte ausschalten können. Ich war kein Teil des eigentlichen Publikums, obwohl ich wahrscheinlich sogar mehr vom Konzert sehen konnte. Mir wurde bewusst, wie wichtig das Zusammenkommen des Publikums auf einem Konzert ist. Mensch wird zu einer Gemeinschaft, das Publikum kreiert eine Atmosphäre, die aus der Distanz nicht zu spüren ist. In dieser Situation war ich allerdings alleine. Wie würde es sich anfühlen, eine Übertragung eines Konzertes in einer großen Gruppe zu schauen? Würde mensch dann nicht auch eine Publikumsgemeinschaft herstellen?
Mainz, Cinestar, 12.05.2022.
Tatsächlich machte ich eine derartige Erfahrung im Mai vor zwei Jahren. An einem einzigen Tag im Jahr 2022 wurde This Much I Know to be True – ein Konzertfilm von Nick Cave und seiner Band – in ausgewählten deutschen Kinos gezeigt. Es handelte sich dabei um jene Art Konzertfilm, der einzig für ein Kinopublikum produziert wurde. Die Aufnahmen fanden in einem Studio statt und kein Publikum war dazu anwesend, einzig die Filmcrew und die Band selbst. Alles in allem machte der Film kein Geheimnis daraus, dass es sich um einen Film handelt. Im Gegenteil: Er machte immer wieder auf seine Materialität aufmerksam. Man sah Lautsprecher, Lampen, Schienen- und Dolly-Systeme. Nick Cave und seine Band blickten mitten in Kameras, performten einzig für die Kameras. Das Set war aufwändig gestaltet, der Film aufwändig geschnitten. Die Performance wirkte wie eine akkurat geplante Choreografie, die Songs saßen, es gab nicht einen Patzer. Der Live-Charakter war nahezu verflogen. Die Situation im Kino war folgende: Während Nick Cave und seine Band auf der Leinwand alles gaben, animierend mit den Kameras spielten, saßen die vielleicht 20 Zuschauenden im Kino schweigend in ihren gemütlichen Kinosesseln und starrten regungslos auf die Leinwand. Der Blick des Publikums wurde gelenkt durch Tausende von Schnitten, wir interagierten nicht miteinander. Galt dieser Film, den wir schauten denn noch als Konzert? Der Live-Charakter war quasi nicht existent, jedoch gab es ein Publikum, eine mehr oder weniger große Menge an Menschen, die extra für diese Performance zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort kamen, die extra für diese Performance Tickets kauften. Wir schauten uns zusammen ein Konzert an, das zwar aufgezeichnet war, jedoch trotzdem als eine Art Konzert gelten konnte. Darüber hinaus schauten wir wahrscheinlich zeitgleich mit anderen Menschen dieses Konzert, die weltweit in verschiedenen Kinos in ihren Kinosesseln saßen.

Konzerte brauchen ein Publikum – das ist klar. Nun kann das Publikum in verschiedenen Formen existieren und der Begriff weit gefasst werden. Es macht einen Unterschied, ob das Publikum vor Ort zusammenkommt, in einem Kinosaal oder zu Hause auf dem Sofa sitzt. Es macht einen Unterschied, ob man die Performance auf der Bühne durch die eigenen Augen, betrachtet, auf Bildschirmen oder als durchkomponierten Film sieht. Es macht einen Unterschied, wenn der eigene Blick durch die Montage gelenkt wird und man nicht selbst entscheiden kann, auf was das Auge gerichtet wird. Bin ich auf einem Konzert, so ist für mich der springende Punkt der, dass ich die Versammlung hautnah erlebe, mit allem, was dazugehört: der beißende Geruch aus Bier und Schweiß, das laute Wummern des Basses, mitsingende Stimmen um mich herum, die dichte Masse aus Menschen und das ständige Berühren von fremden Körperteilen. Publikum bedeutet für mich, Teil einer Gemeinschaft zu sein und zusammen den Moment zu erleben. Dabei müssen Bildschirme nicht zwingendermaßen Distanz schaffen, sondern können eine Begegnungsfläche sein.