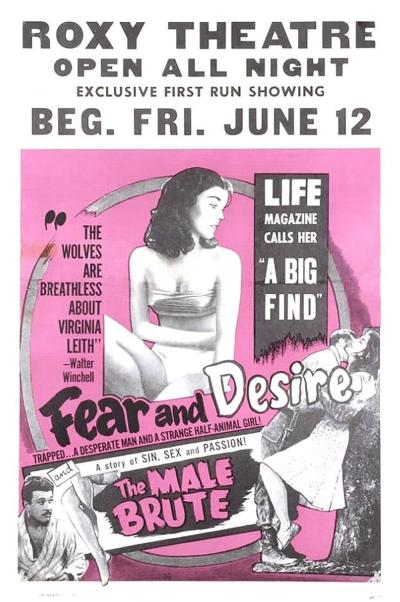In Worte fassen, was Kategorien sprengen möchte
Uneinigkeit. Mit etwas Glück ist das der einzige auswertbare Eindruck den man erhält, befragt man eine beliebige Menge an Personen, was genau Kunst eigentlich sei. Eine breite Fülle an Antworten, die den Rahmen mal weiter, mal enger spannen, scheint geradezu unausweichlich. Alles könne Kunst sein, sagen die einen. Ein Haufen Sperrmüll auf der Straße, streitende Tauben auf dem Bahnhofsplatz, eine schmutzige Gleisunterführung. Sofern diese Dinge mit den richtigen Augen betrachtet würden, mit einer Offenheit, die darin mehr erkennt, als man dem Ganzen im alltäglichen Vorbeigehen zuschreiben würde (man könnte sagen, wenn sie gesehen würden, statt lediglich peripher wahrgenommen), hat das Alltägliche, das Gebräuchliche, ja das mitunter nicht nur als zweckmäßig, sondern auch direkt unästhetisch empfundene, genauso ein Recht darauf, Kunst sein zu dürfen, wie das Gemälde im Museum. Die anderen wollen davon nichts wissen, preisen große Künstler der Vergangenheit und sehen es nicht als kuratorische Meisterleistung, selbigen Sperrmüllhaufen nicht in ein Museum zu stellen. Und doch schaffte es einst ein Pissoir. Eine umfassende Definition zu finden, was als Kunst gelten kann und was nicht, scheint also schlicht unmöglich, allein schon, weil Kunst etwas ist, das sich immer wieder neu definieren, immer wieder neu die eigenen Kategorien sprengen möchte.
Trotzdem erlaube ich mir den Versuch drei Merkmale herauszustellen, die beim Nachdenken über Kunst immer wieder in Erscheinung treten und die vor allem nützlich sind, wenn wir betrachten wollen, wie sich generative künstliche Intelligenz auf das Kunstverständnis von heute auswirket bzw. auswirken muss.
Zunächst scheint es, muss an irgendeiner Stelle eine Intention vorliegen, ein Wille oder eine Absicht einen Kunstgegenstand zu erschaffen, oder ihn als solchen zu interpretieren. Damit geht einher, dass Kunst einen oder mehrere Schöpfer haben muss oder einen oder mehrere interpretierende Geister. Zwischen diesen Polen, Schöpfer und Interpret (die scheinbar zumindest in manchen Kunstformen, wie der Musik bereits vom Wortsinn zusammenfallen) existiert folglich eine gewisse Wechselwirkung. Es wird auf Seiten des Schöpfers eine Weltsicht, Gefühlslage etc. durch das Medium Kunst vermittelt und auf Seiten des Interpreten eine solche verstanden. Nicht selten, und auch oft so gewollt, gleichen sich Vermittlung und Verständnis nicht. Diese Wechselwirkung umfasst also auch Spielraum für etwaige Interpretationen und ist daher ebenso Merkmal der Kunst. Zuletzt bedarf es einer bestimmten Umsetzung, das heißt einer spezifischen Technik, eines Stils, verschiedener Materialien, einer Vorgehensweise, um Kunst zu erschaffen. Diese drei Elemente, Absicht, Wechselwirkung und Technik bilden in gewisser Weise Säulen eines Kunstverständnisses. Im Lichte generativer KI, wie ChatGPT, wandelt sich zwangsläufig unser Kunstverständnis, was sich an diesen Säulen belegen lässt. Um weiter ein stabiles Fundament zu bilden, muss sich, wie wir sehen werden, ihre Bedeutung wandeln.
Intelligente Werkzeuge
Was genau verändert sich in der Kunst, durch die Nutzung von KI? Wenn wir ChatGPT dazu auffordern, eine Dialogszene zu schreiben, geht die Intention selbstverständlich noch von uns aus. Es wird zurückgegriffen auf einen Datensatz von menschlich erstellten Texten und irgendwie schafft es die Maschine daran ungefähr zu erahnen, welches Ergebnis wir wünschen, auch wenn wir bis dahin abermals unsere Eingaben revidieren, ergänzen und am Ende das Meiste wieder verwerfen müssen. Der erzeugte Text starrt uns so als toter Output entgegen, den wir, kuratorisch vorgehend, verändern und dem wir Bedeutung geben müssen. Zu unserem Glück, denn damit bleibt das künstlerische Potential im Menschen. Er ist es, der die Entscheidung trifft, überhaupt zu erschaffen und im Folgenden abwägt, welche Umsetzung er für gelungen hält. KI ist nichts als ein Werkzeug, und doch hat dieses Werkzeug einem Pinsel oder einer Schreibmaschine ganz offenbar etwas voraus. Die dritte Säule der Kunst, die Technik, sie scheint ins Wanken geraten zu sein. Generative KI erlaubt es uns, die Technik auszulagern, das Wie der Umsetzung der Maschine zu übergeben1.
Was diese Werkzeuge für Gefahren mit sich bringen, ist längst hitzig debattiertes Thema. Verschiedenste Künstler zeigen sich besorgt um ihre Zukunft – die WGA streikte nicht zuletzt mehrere Wochen um zu verhindern, dass Filmstudios menschliche Drehbuchautoren durch KI ersetzen. Der Vorwurf steht im Raum, KI sei an „gestohlener Kunst“ trainiert worden. Die Rechtslage ist uneindeutig. All dies bekräftigt nur, dass diese Werkzeuge das Potential besitzen, unsere Gesellschaft nachhaltig zu prägen – in welcher Form wird sich noch zeigen.
Gott ist tot und mit ihm das Originalgenie – und KI tanzt auf den Gräbern
Wenige haben sich bislang damit beschäftigt, dass bevor uns diese Systeme auf ganz reale Weise gefährlich werden (können), allein das bloße Potential, dass wir derzeit in generativer KI entdecken, bereits einen Mord begangen hat. Gemeint ist der Mord am künstlerischen Originalgenie der Romantik. Der einsame romantische Künstler, der in seinem Geist erdenkt und über seinen Körper schafft, kann keinen Nutzen aus KI ziehen, so nimmt diese ihm ja nur einen Teil seiner Ausdrucksweise. Sie nimmt ihm seine Technik für die er ebenso bewundert wird, wie für seine Absicht. Und er sieht sich dadurch bedroht, dass diese Maschine seine Technik bald meistern könnte, darin besser und schneller werden könnte, als er selbst. Es bleibt ihm nichts als die Verteufelung einer Kommerzialisierung seines Schaffens, eine Abgrenzung von alldem, was diese neuen Werkzeuge hervorbringen. Seelenlos und tot, so wie beschrieben, so sei der Output, den diese Maschinen ausspuckten – mit Kunst habe er wenig zu tun. Diese Maschinen, diese undurchschaubaren Algorithmen, sie raubten dem wahren Künstler die Technik und setzten sie in frankensteinischer Manier anders zusammen, unwissend, was sie da überhaupt tun.
Dieser Essay ist keine Trauerrede um diesen Verlust des romantischen Geists. Rückblickend muss man anerkennen, dass es damit viel zu lang gedauert hat. War das Todesröcheln dieses vermeintlichen Genies doch schon lange hörbar. Denn die Wertschätzung eines Originalgenies hängt mit einem gewissen Glauben zusammen. So ist das, was sich dieses Originalgenie anmaßt, im Kern nämlich ein Erschaffen aus dem Nichts – und ein Erschaffen aus dem Nichts ist ein rein göttlicher Akt. Sicher spielt Inspiration in der Kunst schon immer eine entscheidende Rolle, ja lässt sich geradezu eine gesamte Kunstgeschichte aus einem Verlauf der Inspiration ableiten. Aber im Moment der Erschaffung seines Werks, versammelt das romantische Genie nicht nur Daten und baut daraus etwas Neues, sondern haucht dem Ganzen Leben ein. Er formt Adam aus nichts, als der Erde, die er vorfindet. Im selben Maße, wie ein bestimmter Glaube an Gott bestehen muss, um eine institutionalisierte Religion hinzunehmen, muss ein bestimmter Glaube an das Originalgenie bestehen, um die institutionalisierte Kunst hinzunehmen. Was sich schon seit dem letzten Jahrhundert mehr und mehr abzeichnet, wird in Zeiten von KI noch einmal beschleunigt. Der Kunstbegriff wird offener und inklusiver. Das Pissoir gehört eben doch ins Museum. Die intelligenten Werkzeuge unserer Zeit sind es, die uns dieser Tage aufzeigen, dass Kunst unlängst dieselbe Säkularisierung durchgemacht hat, wie die moderne Gesellschaft. Unsere modernen Werkzeuge resonieren, ja sie schreien geradezu heraus, was Nietzsche einst proklamierte: Gott ist tot und wir haben ihn getötet.
Die Abwendung von Gott in der Kunst geschieht dabei nicht nur auf der inhaltlichen Ebene – so ist es doch ein Leichtes zu erkennen, dass in Museen für moderne Kunst ungemein deutlich weniger Mariendarstellungen Platz finden, als in mittelalterlichen Kirchen – sondern eben auch auf dieser Abwendung vom alleinigen Schöpfer. Unlängst ist Co-Autorenschaft in vielen Kunstbereichen keine Seltenheit mehr, sondern vielmehr die Regel und in Zukunft könnte dabei die Kollaboration zwischen Mensch und Maschine im Vordergrund stehen.
Es ist absurd anzunehmen, Kunst könne aus dem Vakuum entstehen. Eine moderne Kunstauffassung muss sich von dem Glauben an einen gottgleichen Schöpfer lossagen. Denn der einstige Gott, geht an der Maschine zu Grunde – ex Machina fällt er vom Himmel.
Kunst als Versammlung – KI, soziale Medien und Memes
An dessen Stelle tritt eine Wertschätzung des Versammelns. Versammlungen finden längst im digitalen Raum statt, das Internet und die sozialen Medien haben binnen kürzester Zeit eine regelrechte Versammlungskultur geschaffen, das Versammeln verschiedenster Elemente und Personen tausendfach effizienter gemacht. Kunst spielt auch hier eine bedeutende Rolle. Es gibt wohl kaum ein geeigneteres Phänomen, um gänzlich moderne, also sich von alten Vorlagen radikal abgrenzende, Kunst zu beschreiben, als Memes. Memes im Internet sind Zeugen globaler Versammlungsprozesse. Diese Prozesse sind jedoch, so sollte man sich stets erinnern, durch Algorithmen bestimmt. Dieses Schema algorithmischer Versammlungen wird von generativer KI par excellence angenommen und angewendet: Wie ein schwarzes Loch saugt die KI Daten auf und kann aus diesen Versammlungen, neue Kunst generieren. Die Absicht bleibt, wie wir gesehen haben, dabei auf Seiten des Menschen, die Technik verlagert sich auf Seiten des Werkzeugs. Die Wechselwirkung zwischen Schaffen und Interpretieren öffnet sich in beide Richtungen. Wer interpretiert, kann wieder neu erschaffen, wird dazu durch diese algorithmisch gesteuerten Versammlungsprozesse zusätzlich motiviert.
Hinter Kunst verbirgt sich also kein Gott mehr, sondern ein Algorithmus, der darüber entscheidet, wie versammelt wird. Ob dieser Algorithmus nun vollständig im menschlichen Hirn oder auf elektronischer Hardware oder zwischen beiden abläuft, bleibt nebensächlich. Das algorithmische Versammeln bestimmt in vielen Bereichen unsere heutige Welt. Es ist nur zeitgemäß dies auch zum zentralen Element moderner Kunstdefinitionen zu erklären.
- 1
Lediglich über die Kategorie des „Wie“ wird noch bestimmt.